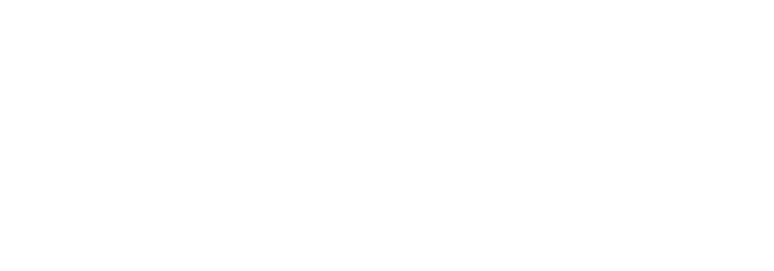Cluster 4: Religion, Gesellschaft, Individuum
Das Cluster 4 beschäftigt sich mit dem spezifischen Beziehungsgeflecht zwischen Religion, Gesellschaft und Individuum, das ein bedeutender Themenkreis vieler am DAI durchgeführter Forschungen ist – in unterschiedlichen Kulturen und über Epochen hinweg. Das Cluster verbindet die Forschungsprojekte zu Heiligtümern und anderen Orten religiös motivierten Handelns und bietet ihnen ein Forum für die Entwicklung und Diskussion von Fragestellungen und Ergebnissen. Es nimmt ganz bewusst neben Heiligtümern mit ihren gesellschaftlich stark normierten oder institutionalisierten Kulten auch andere Orte in den Blick, an denen religiöse Handlungen stattfinden konnten, darunter Wohnhäuser, Produktionsstätten und Nekropolen.