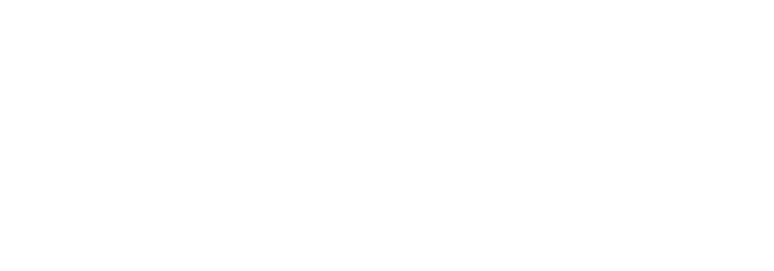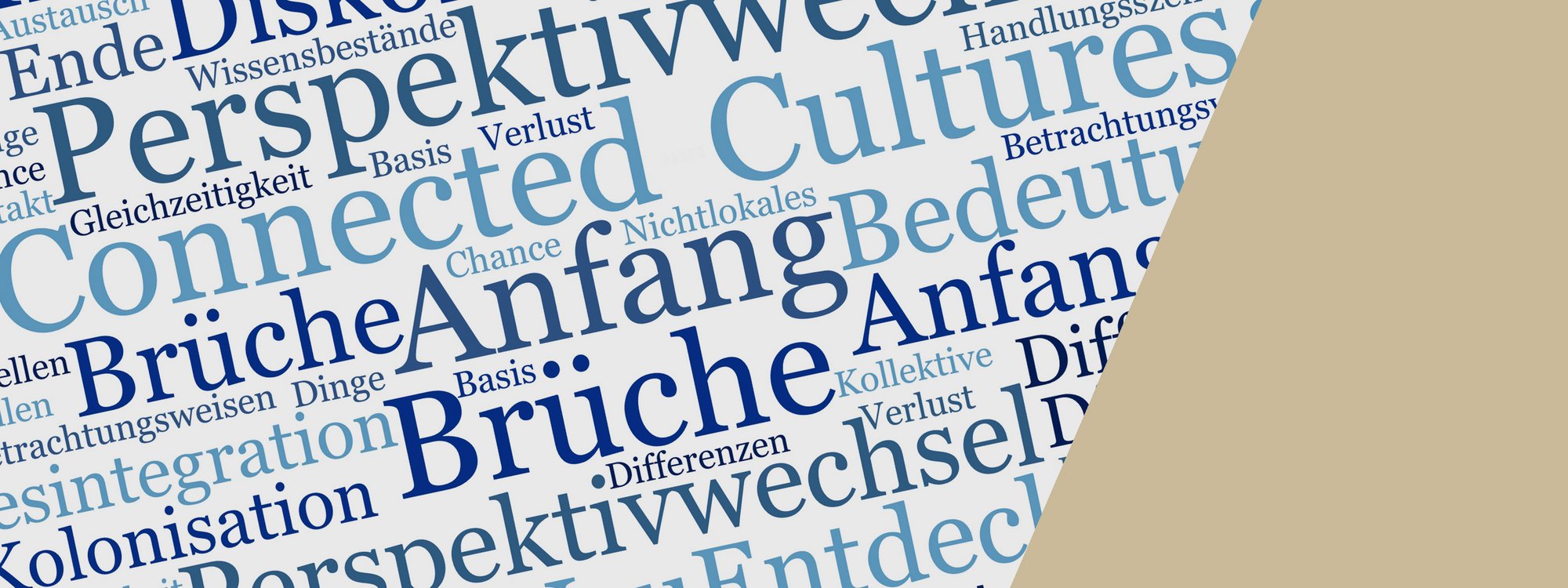Cluster 6: Connected Cultures? Konzepte, Phänomene, Praktiken kultureller Interaktion
Aktuelle Mitglieder des Clusters:
Prof. Dr. Bernstein, Frank; Goethe-Universität Frankfurt; Alte Geschichte | Dr. Reinhold, Sabine; DAI Eurasien; Prähistorische Archäologie, Archäologie Sibiriens | Dr. Schlotzhauer, Udo; DAI Eurasien; Klassische Archäologie des nördlichen Schwarzmeerraumes
PD Dr. Baitinger, Holger; RGZM Mainz; Prähistorie, provinzialrömische, griechische und keltische Archäologie | Dr. Balzer, Ines; DAI Rom; Prähistorische Archäologie, Etruskische und Keltische Archäologie | Bockmann, Ralf; DAI Rom; Klassische Archäologie | Dr. Dan, Anca; CNRS-Paris Sciences Lettres Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident Ecole Normale Supérieure; Altphilologie, Alte Geschichte | Dr. de Saxcé, Ariane; DAI-KAAK; Archäologie | Dr. Dobrovolskaya, Maria; Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences; Anthropologie | Prof. Dr. Dominguez Monedero, Adolfo; Universität Madrid; Alte Geschichte | Dr. Dudeck, Stephan; European University at St. Petersburg; Ethnologie | Dr. Effland, Andreas; Georg-August-Universität Göttingen; Ägyptologie | Prof. Dr. Fornasier, Jochen; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Klassische Archäologie | PD Dr. Gans, Ulrich-Walter; DAI Madrid; Klassische Archäologie | Dr. Gerlach, Iris; DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Sanaa; Vorderasiatische Archäologie | Gilb, B.A. Hannah; DAI Eurasien; Philosophie, Wissenschaftstheorie | Dr. Gramsch, Alexander; RGK Frankfurt; Prähistorische Archäologie/ Museumswesen | Hallgren-Brekenkamp, Moa; DAI Eurasien | PD Dr. Hausleiter, Arnulf; DAI Orient-Abteilung; Vorderasiatische Archäologie, Archäologie der arabischen Halbinsel | Higuchi, M.A. Satoshi; DAI Rom | Dr. Hofmann, Kerstin; DAI RGK; Prähistorische Archäologie und Wissenschaftstheorie | Huber, M.A. Barbara; MPI, Institut für Menschheitsgeschichte, Jena; Vorderasiatische Archäologie, Biomolekulare Archäologie | Dr. Iserlis, Mark; DAI Eurasien | Dr. Japp, Sarah; DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Sanaa; Klass. Archäologie, Yeha, Äthiopien | Jeske, M.A. Ann-Kathrin; DAI Kairo; Ägyptologie | Prof. Dr. Kistler, Erich; Universität Innsbruck; Klassische Archäologie | Dr. Kleinitz, Cornelia; DAI-KAAK | Prof. Dr. Korobov, Dmitrij S.; Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences; Prähistorie, Wissenschaftstheorie, Völkerwanderungszeit | Köster, M.A. Marlene; DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Sanaa; Prähistorische Archäologie, World Heritage Studies | Dr. Lätzer-Lasar, Asuman; Universität Erfurt; Klassische Archäologie, Religionsgeschichte | Lukas, M.A. Dominik; University of Chicago; Prähistorie | Mancarella, Clara; DAI-Außenstelle Sanaa; Vorderasiatische Archäologie | Prof. Dr. Marzoli, Dirce; DAI Madrid; Prähistorische Archäologie, Archäologie der Iberischen Halbinsel, Phönizierforschung | Dr. Miller, Bryan; University Michigan | Mossong, Isabelle; DAI-AEG | Dr. Mühl, Simone; DAI-Orient; Vorderasiatische Archäologie | PD Dr. Nakoinz, Oliver; Johanna Mestorf Akademie, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Christian-Albrechts-Universität | Prof. Dr. Naso, Alessandro; Universität Neapel; Etruskologie | Prof. Dr. Pongratz-Leisten, Beate; New York University; Ancient Near Eastern Studies | Dr. Rasbach, Gabriele; RGK Frankfurt; Provinzialrömische Archäologie | Dr. Rummel, Christoph; DAI RGK; Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie | Santos Retolaza, Marta; Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries; Klassische Archäologie, Archäologie d. Iberischen Halbinsel, Museumswesen | Schierl, M.A. Thomas; Mülhäuser Museen; Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterliche Geschichte und Biologische Anthropologie | Schrauder, M.A. Julienne N.; DAI RGK Frankfurt; Ägyptologie | Schröer, Sandra; DAI-RGK | Ph.D. Schülke, M.A. Almut; Kulturhistorik Museum, Museum of Cultural History; Landschaftsarchäologie, Neolithische Archäologie | Dr. Sigl, Johanna; DAI-KAAK | Dr. des. Sklebitz, Anne; Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin; Prähistorie, chinesische Keramik | Dr. Uhl, Regina; DAI Eurasien; Prähistorie | Dr. Voß, Hans-Ulrich; RGK Frankfurt; Prähistorie | Prof. Dr. Wagner, Mayke; DAI Eurasien; Sinologie, Orientarchäologie | Dr. Wigg-Wolf, David; RGK Frankfurt; Numismatik | Dr. Wunderlich, Maria; Universität Kiel; Prähistorie und Kulturelle Anthropologie
2023 Jahresbericht Cluster 6 »Connected Cultures?« Konzepte, Phänomene, Praktiken Kultureller Interaktion
Das Cluster »Connected Cultures?« Konzepte, Phänomene, Praktiken kultureller Interaktion setzte 2023 die Diskussion der drei Themen mit dem Aspekt »Diskontinuität, Desintegration, Differenz« fort. Das Treffen der Gruppe fand vom 7. bis 9. November 2023 an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck statt. Die Einbindung der Diskussion des DAI Clusters in eine Lehrveranstaltung für Master-Studierende und an einer Universität in Österreich betonte die Bedeutung, welche die Nachwuchsförderung und die internationale Vernetzung des Clusters 6 hat. Die Studierenden der Universität Innsbruck werden einen separaten Konferenz-Review in h-soz-kult veröffentlichen.
„Jedes Zusammentreffen und somit die Auseinandersetzung mit einer neuen Gruppierung stellt die eigene Position in Frage und bricht Routinen sozialer Praxis auf. Disruptionen sind die Folge und ergeben oft einen Anfang und gleichzeitig ein Ende kultureller Prozesse, die gerade im Zusammenhang mit kultureller Interaktion zum Tragen kommen. Demzufolge ist Kontakt immer auch eine Art Zäsur, denn es existiert ein Davor und ein Danach.“ Mit diesem dem Call for Paper entnommenen Fokus fanden sich in Innsbruck 15 Vortragene zusammen, die von theoretischen Ansätzen und Zeiträumen in der Bronzezeit bis zu modernen Beispielen mit einem ethno-archäologischen Ansatz reichten. Das Programm und die Abstracts sind auf der Homepage des Clusters unter https://www.dainst.org/forschung/projekte/cluster-6-connected-cultures-konzepte-phaenomene-praktiken-kultureller-interaktion/5734 mittlerweile abrufbar.
Zwei Grundsatzreferate von Asuman Lätzer-Laser und Sabine Reinhold führten ins Thema ein. Das erste mit einem theoretischen Fokus auf den „Lücken in der longue durée“ und der Frage, inwiefern unsere Methodengerüste der Archäologie überhaupt in der Lage sind, disruptive Momente zu erfassen und Brüche adäquat zu beschreiben. Warum untersuchen wir Brüche, und wie lassen sich solche in einem Kontinuum einordnen? Das Fazit von Referat und Diskussion war, die Brüche hängen von der Perspektive der Akteure ab und sind Setzungen, die oft aus der Forschung kommen. Das zweite Referat zu „Facetten der Diskontinuität, Desintegration und Differenz“ zielte ebenfalls auf die Longue durée, doch mit einem anderen Fokus: Wie persistent sind die Unterschiede gesellschaftlicher Teil-Gruppen, die in und nach einem kulturellen Kontakt verschmolzen sind? Was sind also die Nachwirkungen des Kulturkontaktes über Jahrhunderte? Welche Bruchlinien verlaufen entlang der ehemaligen Identitäten? Im Ergebnis zeigte sich, dass der Kulturkontakt sehr lange nachwirken kann und neue Identitäten weiterhin prägt.
Insgesamt zeigte sich bei den Vorträgen die große Spannbreite von Brüchen und unterschiedliche Wirkmächtigkeiten von Diskontinuitäten, z.B. ephemere Kontakte versus dauerhafte Veränderungen etwa im Siedlungsgefüge oder der Religion. „Bruch“ wird oft als totaler Begriff verwendet, bei dem sich alles ändert. Die Diskussion zeigte, dass dem nicht so ist. Brüche sind Teil von vielschichtigen Prozessen und betreffen häufig nur Aspekte des Lebens.